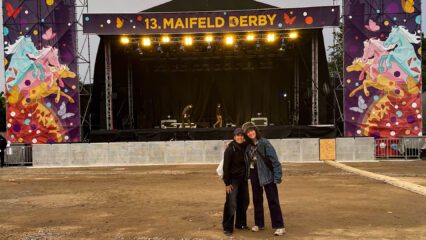Wie du vielleicht schon bemerkt hast, ist Freiburg die ultimative Fahrradstadt – passend dazu hast du deinem gestohlenen Fahrrad mit dem Song „Can I Say“ eine Art Liebesbrief gewidmet. Hast du das inzwischen verarbeitet?
Wir sind heute Mittag erst in Freiburg angekommen, ich habe die Stadt also noch gar nicht richtig gesehen. Aber ja, das ist toll – und ja, „Can I Say“ ist entstanden, weil mir vor zwei Jahren in Athen mein Fahrrad gestohlen wurde. Ich erinnere mich, wir kamen gerade aus dem Lockdown, es war Weihnachten. Ich war mit meiner Partnerperson unterwegs, und wir hatten unsere Fahrräder zusammen abgeschlossen. Mein Fahrrad war ein faltbares Dahon, das ich von einem berühmten Musiker in Griechenland gekauft hatte – er war in den 60ern und 70ern ziemlich bekannt. Sein Name ist Kostas Tournas, ich liebe ihn. Er ist jetzt ungefähr 70, und ich hatte das Fahrrad von ihm gekauft, ohne zu wissen, dass er es ist. Ich hatte nur jemanden angerufen und gesagt: „Ich sehe, du verkaufst ein Fahrrad, ich möchte es kaufen.“ Und als ich dann zu ihm nach Hause kam, um es abzuholen, kommt er raus mit dem Fahrrad und ich war so: „Oh mein Gott, du bist Kostas Tournas.“
Also war dieses Fahrrad auf viele Arten etwas Besonderes. An dem Tag wurden dann beide unsere Fahrräder gestohlen, und das passierte alles innerhalb von fünf Minuten. Ich war wirklich traurig, es auf diese Weise zu verlieren. Dann begann ich mit dem Song. Ich spielte auf meinem kleinen Klavier zu Hause, und das waren die ersten Worte: „Can I say, I really miss you?“ Später im Song heißt es: „What I wouldn’t give to kiss“ – ich habe mein Fahrrad natürlich nicht wirklich geküsst, aber der Song begann mit meinem Fahrrad und wurde dann zu einem Liebeslied.
Trauerst du dem Fahrrad also immer noch nach?
Ich glaube, man kommt nie wirklich darüber hinweg, weil es sich ein bisschen so anfühlt, als würde jemand deine Kindheit stehlen, wenn dir ein Fahrrad geklaut wird. Ich übertreibe natürlich, aber ein Fahrrad bedeutet ein Gefühl von Freiheit und jemand nimmt dir das einfach weg. Ich habe mir später ein neues Fahrrad gekauft, aber es ist eben nicht dasselbe.
Du hast 2020 angefangen, an deinem Album Adagio zu arbeiten. In der Zwischenzeit hast du aber 2022 Up and Away veröffentlicht. Was ist passiert und warum dieser Umweg?
Musiker schreiben ihre Alben meistens zwei, drei Jahre bevor sie veröffentlicht werden. Up and Away wurde größtenteils Ende 2018, 2019 aufgenommen. Ich habe es 2020 an Sub Pop geschickt und dann kam COVID. Es hat also einfach ein paar Jahre gedauert, bis es veröffentlicht wurde. In der Zwischenzeit hatte ich angefangen, einige Songs von Adagio zu schreiben – aber die meisten habe ich dann doch 2023 geschrieben. Der Großteil des Albums ist näher an 2024 entstanden.
Wie ist es für dich, diese alten Emotionen wiederzuerleben, wenn du die Songs performst?
Ich denke, wenn man einen Song schreibt, ist es wie durch ein Schlüsselloch zu schauen. Und wenn man ihn dann aufführt, versteht man ihn wirklich. Die Studioerfahrung ist etwas ganz anderes. Das ist wie Kochen und dann isst du tatsächlich. Jetzt erlebe ich die Songs wirklich.
Bei deinem Song Omorfo Mou hast du zuerst das Instrumental geschrieben.
Was hat dich dazu inspiriert, zum ersten Mal den Text in deiner Muttersprache zu schreiben? Was war diesmal anders?
Was bei diesem Song anders war: Ich hatte zuerst das Instrumental geschrieben. Und das hatte so griechisch-anatolische Elemente. Ich hatte es 2020 geschrieben und dann einfach zur Seite gelegt. Es gab keinen Text. Dann habe ich es später wieder angehört und versucht, auf Englisch zu singen – aber das ging einfach nicht. Das Instrumental hat mich regelrecht dazu gedrängt, auf Griechisch zu singen. Alles, was ich versuchte zu singen, kam auf Griechisch heraus. Und ich dachte mir: Was zur Hölle passiert hier? Ich habe noch nie einen Song auf Griechisch veröffentlicht. Ich glaube, das Instrumental hat mich dazu gebracht, griechische Lyrics zu schreiben.
Was für einen Unterschied bemerkst du beim Schreiben und Performen in deiner Muttersprache?
Es ist auf jeden Fall etwas Intimeres. Wenn ich auf Griechisch singe, ist das Gefühl ein bisschen näher an mir dran – obwohl Englisch auch irgendwie meine Sprache ist. Ich habe Griechisch und Englisch gleichzeitig gelernt. Aber mein ganzes Leben lang habe ich mit meinen Eltern, meinen Freunden, einfach allen auf Griechisch gesprochen. Es fühlt sich also vertrauter an. Es ist ein anderes Gefühl. Ein Gefühl, das ich mag. Ich genieße es. Es ist neu für mich, macht Spaß.
Welcher Song auf dem Album hat eine besondere Bedeutung für dich?
Oh, ich weiß nicht genau. Ich glaube, sie haben alle eine besondere Bedeutung. Ich werde oft emotional bei „80 Days“, würde ich sagen, aber das liegt am Inhalt des Songs. Er handelt von etwas, das mich damals beschäftigt hat. Es geht viel ums Reisen. Ich wurde von Menschen inspiriert, die ich kenne, die ständig unterwegs sind. Die bleiben nie länger als vier oder sechs Monate an einem Ort. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie es ist, wenn man so oft den Ort wechselt. Man bindet sich an nichts. Man macht einfach weiter.
Bisher hast du mit Produzenten wie Redinho gearbeitet, aber keine Features gemacht. Wie war es, zum ersten Mal mit jemand Neuem zusammenzuarbeiten – wie bei „Baby Brazil“ mit Rafael Cohen alias Las Palabras?
Bei meinen ersten beiden Alben habe ich mit einem Produzenten gearbeitet, aber bei Up and Away haben wir auch gemeinsam Songs geschrieben und Tom (Redinho) hat produziert. Mit Rafael Cohen, sein Künstlername ist Las Palabras, war es wirklich schön. Wir haben uns über meinen Verlag kennengelernt und angefangen zu schreiben. Er lebt in New York, ich war natürlich in Griechenland. Wir haben viel Musik ausgetauscht, die wir mögen. Und das hat gut gepasst, weil wir den gleichen Geschmack haben. Es war super, mit Rafael zu arbeiten.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss: Welchen Wunsch würdest du dir gerne bald erfüllen?
Oh! Mein Fahrrad finden (lacht). Gott, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich lebe gerade meinen Wunsch. Ich hoffe einfach, dass ich noch viele, viele Jahre so weitermachen kann wie jetzt. Dass sich die Musik weiter verbreitet, die Menschen sie mögen – und dass sie glücklich macht.