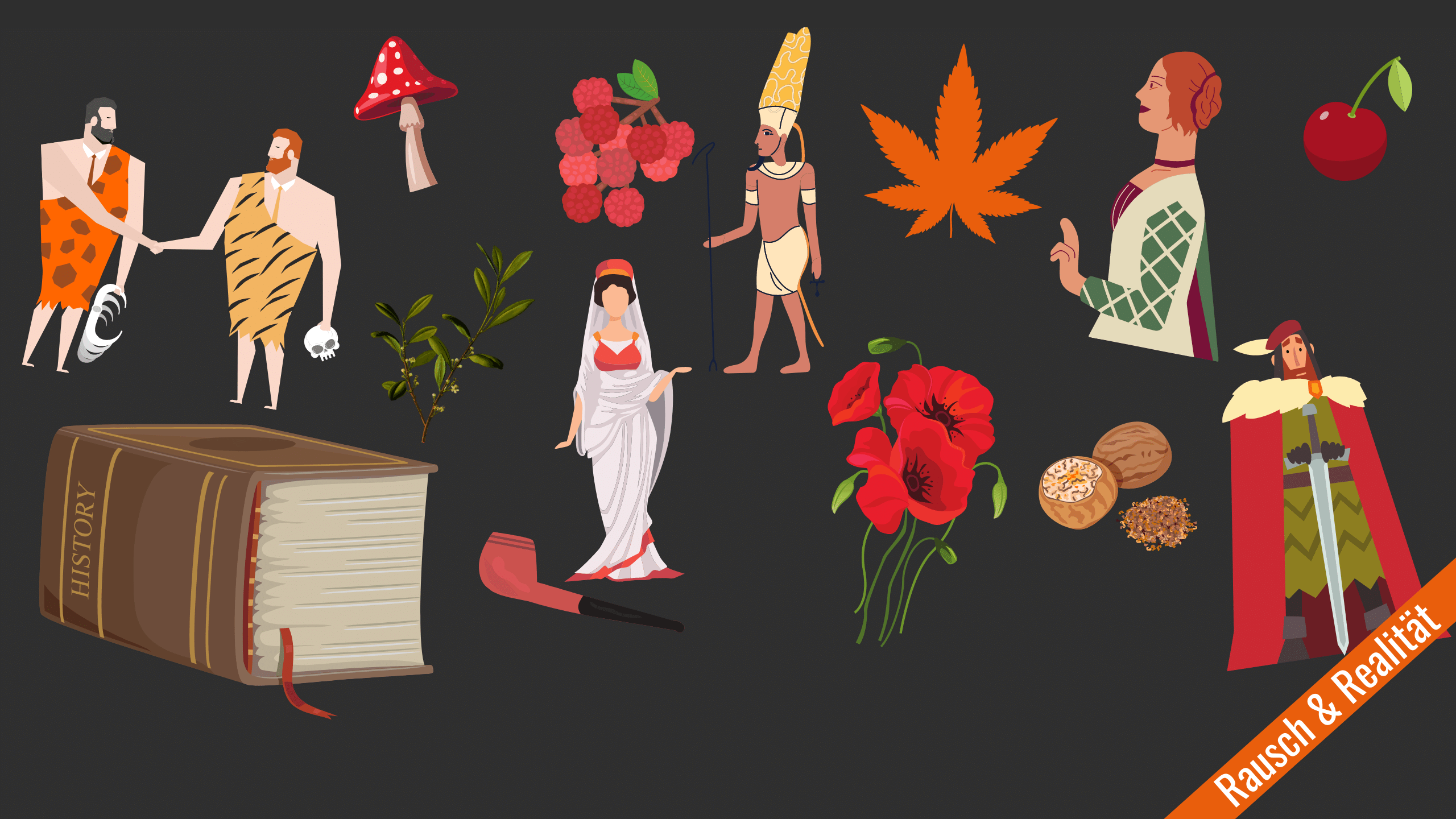Guten Tag Herr Tauschek, Sie sind Professor für Kulturanthropologie und beschäftigen sich unter anderem mit Ritualen. In der Ersti-Woche zum Beginn des Wintersemesters treffen sich junge Menschen, die miteinander ein neues Studium beginnen, zum ersten Mal. Bei dieser Begegnung der Erstsemester und der Fachschaften wird in der Regel viel Alkohol konsumiert. Warum ist das so?

Die Ersti-Woche hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre als immer deutlicherer Ritualkomplex herausgebildet. Sie ist für Schülerinnen und Schüler, die jetzt zu Studierenden werden, offensichtlich ein wichtiges Übergangsritual. Eine klassische Interpretation des Ethnologen Victor Turner ist, dass diese Übergangsrituale den von Risiken begleiteten Statuspassagenwechsel absichern.
Ein klassisches Beispiel ist die Jugendweihe in der DDR oder die Erstkommunion in der katholischen Kirche. Übergangsrituale bringen Menschen in den nächsten Status. Die Ersti-Woche ist dafür ein gutes Beispiel. Dort wird der Status des Schülers oder der Schülerin abgelegt und man kann in den neuen Status des, der Studierenden aufgenommen werden. Und in Übergangsritualen, wie in Ritualen überhaupt, spielen rauschhafte Zustände mitunter eine wichtige Rolle.
Sie waren ja auch einmal Student an der Albert-Ludwigs-Universität. Wie haben Sie die Ersti-Woche wahrgenommen?
In meiner Studienzeit gab es das gar nicht. Es gab am Institut zwar eine Woche für die Studienanfänger*innen und eine Ersti-Hütte, da hat man auch etwas getrunken, aber dieses Trinken im öffentlichen Raum mit Stadtrallyes und Kneipenabenden gab es in der Form nicht. Das ist schon eine Praxis, die in den letzten Jahren expansiv geworden ist.
Die Ersti-Woche mit hohem Alkoholkonsum ist also erst in den letzten Jahren entstanden?
Entstanden würde ich nicht sagen, denn da müsste man jetzt ganz genau vergleichen, ob es das an anderen deutschen Hochschulen oder in anderen Ländern vielleicht schon früher gab. In den USA an den Colleges gibt es beispielsweise auch starke Initiationsrituale, bei denen Alkohol eine Rolle spielt. Entstanden also vielleicht nicht, aber es hat sich ungefähr in den letzten zehn Jahren etabliert als fester, ritualisierter Bestandteil des Studieneintritts.
Inwiefern bindet denn so ein rauschhaftes Trinken die Menschen?
Bei Übergangsritualen bildet sich immer eine Form von „Communitas“ – das ist ein Begriff von Victor Turner – heraus, also eine zeitlich befristete Form der Gemeinschaft und das kann man an den sogenannten „Ersti-Ritualen“ – das ist ja ein ganzer Komplex – auch sehen.
Wieviel Zwang steckt hinter solchen Ritualen, ausgehend von der Gruppe auf die Teilnehmenden?
Jedes Ritual hat einen inkludierenden sowie einen exkludierenden Charakter. Es schließt Menschen in eine Gemeinschaft ein, schließt aber gleichzeitig die anderen aus. Insofern hat man das Zwanghafte eigentlich in allen Ritualen. Es ist mitunter ganz schwierig, sich Ritualen zu entziehen. Wenn man im dörflichen Kontext aufgewachsen ist, kennt man das vielleicht. Da gehört die Teilnahme an bestimmten Ritualformen einfach dazu, selbst wenn Menschen es gar nicht so sehr, beispielsweise ideologisch oder konfessionell, vertreten. Rituale sind in gewisser Hinsicht auch bindend für eine Gemeinschaft, aber schließen eben diesen Zwangsaspekt mit ein.
Sind die verschiedenen (Trink-)Spiele, wie zum Beispiel, dass sich Erstsemester öffentlich entkleiden, auch Teil des Rituals?
Das Ludische, Spielerische gehört auch zu den Übergangsritualen. Rituale setzen Energie frei, die sich dann in unterschiedlichen Arten und Weisen ausprägt. Zum Beispiel durch Kreativität, durch die verschiedenen Formen von Feiern und eben auch durch das Ludische. Das so-tun-als-ob, das zu vielen Ritualen dazugehört, hat auch immer eine Ventilfunktion.
Das ist dann eher eine psychologisierende Deutung. Ventilfunktion heißt, dass für einen begrenzten Zeitraum Regeln außer Kraft gesetzt werden. Beispielsweise sind Spiele oder der Alkoholkonsum in dieser Intensität im öffentlichen Raum nicht üblich, in dem rituellen Rahmen ist das aber möglich. Das heißt aber auch, dass, wenn der rituelle Rahmen vorbei ist, man in die reguläre Ordnung des Studiums kommt. Ein anderes, klassisches Beispiel wäre natürlich Karneval. Dieser ist kulturhistorisch auch ein Übergangsritual. Regeln werden außer Kraft gesetzt, es gibt Rausch, Sexualität, Feiern und am Aschermittwoch endet dann alles und die alltägliche Ordnung ist wiederhergestellt. Und sicher ist die Erstiwoche gewissermaßen eine Form der Eventisierung und auch der Karnevalisierung, weil es auch dort um eine umgedrehte Ordnung geht.
Warum gibt es überhaupt diese Rituale beim Übergang von einer in die andere Lebensphase?
Aus Ihrer Perspektive wäre das zum Beispiel: Sie haben das Abitur gemacht, dann ist erstmal vieles unklar. Sie kennen die kulturellen sowie materiellen neuen Räume noch nicht, in denen Sie sich bewegen und Sie kennen die neuen Sozialformen noch nicht. Also stellt sich die Frage, wie verhalte ich mich überhaupt an der Hochschule und welche Regeln gilt es einzuhalten. Genau das sichert ein Ritual ab. Es sichert ab, dass Sie ankommen in der neuen lebensweltlichen Situation.
Gibt es Alternativen zum Alkohol für die Übergangsrituale?
Da würde ich wieder sagen, dass das eine Frage des Feldes ist. Ich würde kulturwissenschaftlich beobachten, ob Alternativen entwickelt werden. Ich bin mir aber sicher, dass der institutionelle Rahmen dazu führen kann, dass sich etwas in dem Ritual verändert. Wenn beispielsweise ein Verbot ausgesprochen wird, dann reagieren Akteur*innen natürlich auch kreativ darauf oder weichen auf andere Räume aus, die Praxisform verändert sich aber vielleicht auch.
Es gibt an der Uni ja auch bereits neue Ideen. Die Geografie-Fachschaft versucht zum Beispiel ein Gegenkonzept zu der Ersti-Woche mit Alkohol aufzustellen und bietet stattdessen andere gemeinsame Aktivitäten an.
Das finde ich aus mehrerlei Hinsicht interessant. Erstens ist es ein Beleg dafür, wie wichtig und traditionalisiert diese Form des Übergangsrituals ins Studium ist, die man da beibehält. Zweitens ist es interessant, weil auch gesamtgesellschaftliche Diskurse zur Rolle von Alkohol, Drogen oder Rausch widergespiegelt werden. Das sieht man überhaupt bei allen Bräuchen, dass sie natürlich dynamisch auf den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie praktiziert werden, reagieren und sich dann auch mitunter verändern müssen.
Wie sieht es denn Ihrer Meinung nach mit der Entwicklung des Rituals der Ersti-Woche in der Zukunft aus?
Erst einmal generell: Rituale verändern sich permanent. Auch wenn man auf den ersten Blick den Eindruck hat, dass sie immer gleichbleiben, gehört Veränderung dazu. Jedes Jahr ist es etwas anders. Wie sich das Ganze entwickelt, hängt erstens damit zusammen, ob sich bei den Menschen, die das praktizieren, schon ein Verständnis von so etwas wie Traditionalität entwickelt hat. Und Traditionalität bedeutet gesellschaftlich meistens: Das müssen wir weitermachen, weil wir das schon „immer“ gemacht haben.
Kulturwissenschaftlich betrachtet sieht man aber eben, dass sich permanent Veränderungen ergeben, beispielsweise durch neue Studierende, die sensibilisiert sind bezüglich des Alkoholkonsums beispielsweise. Dann verändert sich etwas. Eine Prognose würde ich vielleicht nur in der Hinsicht abgeben, dass es immer Anpassungsphänomene gibt, die sich am äußeren Rahmen, an Regularien oder an inneren Akteur*innen, die etwas anders verstehen, orientieren. Aber ich glaube, dass die Ersti-Woche als Komplex, der den Übergang begleitet, bestehen bleiben wird.