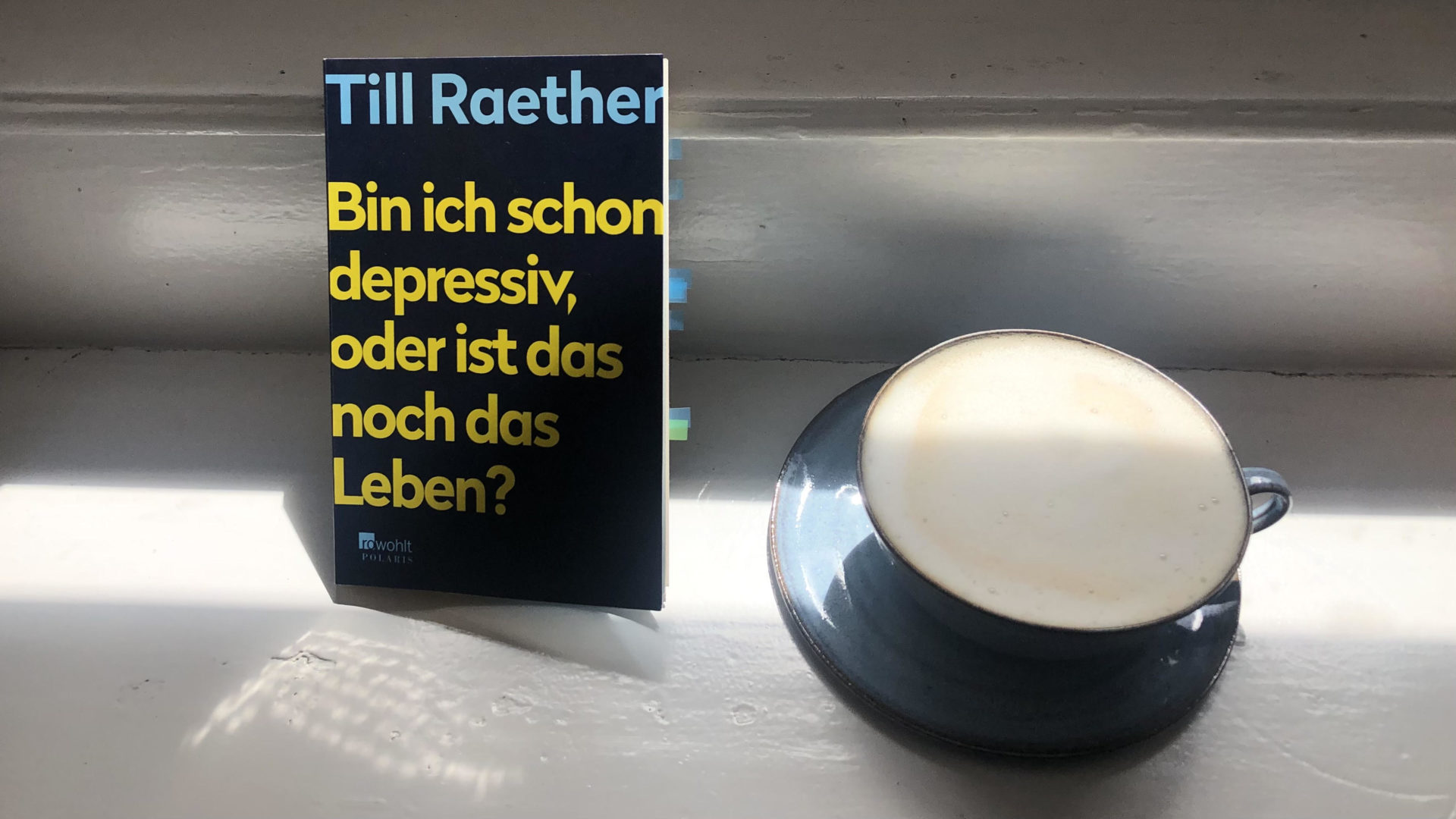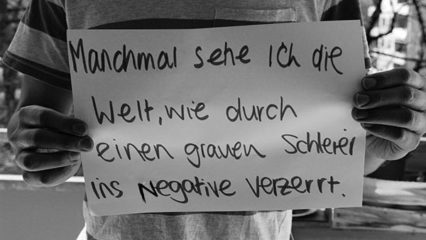Hallo Till! Du hast ein Buch über deine Depression geschrieben, das im März 2021 erschienen ist. Wie geht es dir gerade?
Als das Buch Ende letzten Jahres fertig war, habe ich hin und wieder gedacht: Ach, das war mal wieder ein bisschen vermessen, ein Buch über Depressionen zu schreiben. Eigentlich geht es mir doch ganz gut. Aber seit Anfang des Jahres geht es mir wieder gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, es war völlig angemessen und richtig, ein Buch über Depressionen zu schreiben. Im Moment würde ich die Frage “Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben” ganz klar mit depressiv beantworten. Gleichzeitig gibt es auch immer die Wechselwirkung von Depression und Pandemie, die sich zusammen verstärken.

Ist das denn eine Frage, die du dir immer noch stellst? Ob du schon depressiv bist oder es noch das Leben ist?
Ich finde es auch nach den Jahren, die ich mich damit beschäftige, immer noch schwierig einzuschätzen, ob ich Situationen als besonders schlimm empfinde, weil ich depressiv bin. Ich traue mir manchmal nicht so richtig in der Bewertung von Schwierigkeiten, die ich habe. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht umgekehrt schon so abgestumpft bin, dass ich manche Dinge gar nicht mehr richtig zur Kenntnis nehme, weil ich denke: Na ja, dass es mir nicht so gut geht, ist ja eh klar.
Du schreibst in deinem Buch und in einem Artikel für das SZ-Magazin, dass deine Depression im Frühling besonders schlimm ist. Warum ist das so?
Wenn es draußen so schön wird, entsteht ein schlechtes Gewissen und eine Ausgeschlossenheit, weil ich es nicht so genießen kann wie die anderen. Gleichzeitig sagen dann Freund*innen und Kolleg*innen: “Geh doch einfach mal raus, dann wird es dir schon besser gehen”. Dabei kommt man in einen unangenehmen Zwiespalt. Auf der einen Seite frage ich mich dann: Glaubst du, ich komme selbst nicht auf die Idee? Und auf der anderen Seite denke ich: Ja, das weiß ich, aber ich kann es einfach nicht, und ich kann es dir auch nicht erklären. Der Druck, etwas Schönes zu machen und sich zu erklären ist bei gutem Wetter größer. Man wird noch mehr mit der eigenen Unfähigkeit konfrontiert, als wenn es einfach regnet und man sowieso nichts machen kann.
Ich bin eigentlich ganz froh, wenn es zwischendurch wieder regnet. Dann kann man den normalen depressiven Lifestyle, nämlich zu Hause auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun, als “es sich gemütlich machen” verbrämen. Das ist dann zwischenzeitlich gesellschaftlich akzeptiert.
Du beschreibst in deinem Buch oft dieses “Sich-Zusammenreißen”, wozu man vielleicht bei gutem Wetter einen noch größeren Druck spürt. Du beschreibst das als sehr zwiespältig. Einerseits ist es furchtbar, einer Person zu sagen, sie solle sich einfach mal zusammenreißen und ihre Gefühle zurückstellen, um Unannehmlichkeiten für andere Leute zu vermeiden. Andererseits funktioniert es ja leider doch oft, sich zum Beispiel dazu zu zwingen raus zu gehen.
Ich glaube, der Trick ist, dass man sich nicht mehr so absolut beurteilt oder verurteilt wegen dieser Verhaltensweise. Bei mir war das zumindest so. Wenn ich es nicht schaffe, “mich zusammenzureißen”, denke ich nicht mehr, ich habe versagt, sondern: Es ging halt einfach nicht, was soll’s! Ich versuche seit ein paar Jahren, in der Hinsicht etwas nachsichtiger mit mir selbst zu sein und auch die schlechten Phasen anzunehmen als etwas, was mir passiert, wofür ich aber nichts kann. Deshalb kann ich auch nicht versagen. Klar hilft es manchmal, sich zusammenzureißen, aber manchmal geht das nicht, und das ist auch okay.
Du schreibst, dass du aufgrund deiner “nur” leichten bis mittelschweren Depression oft das Gefühl hattest, nicht depressiv genug zu sein. Empfindest du das immer noch so?
Ich habe mich früher sehr nach dieser Klarheit gesehnt. Ich habe gedacht: Wenn es mir schlechter ginge, dann würde ich wenigstens mal richtig ausfallen und es wäre ganz klar, für Außenstehende und für mich. Für diese Gedanken habe ich mich auch gleich wieder schuldig gefühlt. Ich glaube, dass ich es geschafft habe, diese Klarheit für mich selbst anders herzustellen. Ich habe gelernt, dass es mir nicht unglaublich schlecht gehen muss, damit es mir besser gehen darf. Es kann einem auch besser gehen dürfen, wenn es einem nur mittelschlecht geht.
Du hast schon seit 20 bis 30 Jahren Depressionen. Wieso hat es so lange gedauert, bis du dir professionelle Hilfe gesucht hast?
Zum einen lag es an diesem Schuldgefühl. Ich dachte, mir geht es nicht schlecht genug, anderen geht es viel schlechter. Dazu habe ich gedacht: Mir kann sowieso keiner helfen, es ist so komplex. Es war eine Mischung aus diesem Schuldgefühl und einer Selbstüberhöhung. Das wurde bei mir auch durch äußere Ereignisse befeuert. Als ich mit Anfang 20 gerade angefangen hatte zu studieren, bin ich zur psychologischen Studienberatung gegangen. Da wurde mir empfohlen, mir eine Lerngruppe zu suchen. Deshalb dachte ich, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn sie mir nur empfehlen, eine Lerngruppe zu suchen. Ich hatte immer äußere Erklärungen, warum ich mich immer so schlecht fühlte. Es lag an der neuen Stadt, am neuen Job oder an der Trennung. Erst als ich keine Erklärung mehr hatte, wurde mir klar, dass es so weit war, dass ich mir helfen lassen musste.
Du schreibst auch von deiner Mutter, die schwere Depressionen hatte. Hattest du das Gefühl, dass dir das geholfen hat, deine eigene Depression zu erkennen? Oder war es eher das Gegenteil?
Ich glaube, dass ich dadurch sensibilisierter für das Thema war, dass es aber auch gleichzeitig zu einer Abwehr geführt hat. Ich habe gedacht, depressiv sein heißt so schwer depressiv zu sein wie meine Mutter. Zugleich war das Thema dadurch auch angstbesetzter. Ich wollte es vor allem in den Phasen, in denen es mir gut ging, ignorieren, weil ich mich damit nicht konfrontieren wollte. Vielleicht wollte ich mich auch mit der Geschichte meiner Mutter nicht auseinandersetzen.
Das ist ein tückisches Phänomen bei Depressionen, dass sie sich wahnsinnig gut verdrängen lassen, wenn es einem oder einer gut geht. Und in den Phasen, in denen man sich schlecht fühlt, fehlt einem die Energie, der Mut und das Durchhaltevermögen, um sich um Hilfe zu kümmern. Die schwere Depression meiner Mutter hat eher dazu geführt, dass ich meine Depression verdrängt hab, während es mir gut ging.
Als du dich dann um deine Depression gekümmert hast, hast du erst eine Verhaltenstherapie gemacht. Du schreibst aber, dass die dich eher zu einem gut funktionierenden Depressiven gemacht hat.
Es war auf alle Fälle ein ganz wichtiger erster Schritt, bei dem ich gemerkt habe, es gibt Dinge und es gibt Instrumente, Verhaltensweisen, die mir helfen. Für mich ist dadurch eine gewisse Klarheit entstanden, dass ich gemerkt habe, ich habe etwas, wogegen man wirklich etwas tun kann.
Ich habe mich allerdings damals auch für die Verhaltenstherapie entschieden, weil ich dachte, ich will nicht von meiner Kindheit erzählen, sondern mir geht es nur um die Gegenwart. Dabei habe ich einen Teil ausgeblendet, mit dem ich mich nicht beschäftigen wollte. Deshalb hat es auch nur eine Zeit lang für mich gut funktioniert. Irgendwann waren die Techniken und Verhaltensweisen, die ich in der Therapie gelernt habe, für mich abgenutzt. Weil ich mich nicht mit meiner Vergangenheit und meinen Emotionen beschäftigt habe, war es für mich nicht nachhaltig genug. Aber das ist sicher total individuell.
Jetzt machst du eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Funktioniert die besser für dich?
In der tiefenpsychologischen Therapie finde ich faszinierend, dass ich oft hingehe und denke, eigentlich nichts zu erzählen zu haben. Dann fragt mich die Therapeutin, wie es mir heute geht, und ich erzähle etwas für meine Begriffe Banales, was mir auf dem Weg dahin auf dem Fahrrad passiert ist. Und durch zwei oder drei Nachfragen oder dadurch, dass ich ins Erzählen komme, gerate ich zusammen mit der Therapeutin in so Bereiche, wo ich merke: oh, da wäre ich alleine nicht hingekommen.
Ich empfinde meine Therapeutin auch als eine Art Anwältin für mich gegenüber mir selbst. Wenn ich mich wieder wahnsinnig fertig machen möchte, weil ich mich peinlich aufgeführt habe oder etwas nicht gemacht habe, nimmt sie mich oft vor mir selbst in Schutz. Das ist eine sehr interessante und für mich neue Erfahrung.
Du hast auch angefangen Medikamente zu nehme. Welche Rolle spielen die für dich?
Es war für mich wichtig zu sehen, dass ich mich nicht damit abfinden muss, wie ich mich fühle. Ich habe Glück gehabt, bei mir hat ein sehr gängiges Antidepressivum relativ schnell angeschlagen. Es hat eine antriebssteigernde Wirkung. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich ein bisschen Freude daran hatte, Dinge zu erledigen. Es hat mir auch den Antrieb gegeben, mich auf die Suche nach einem Therapieplatz zu begeben. Am Anfang war das für mich auch mit Angst und Schuldgefühl behaftet. Ich habe mich gefragt, ob das nicht Schummeln ist, ob man es sich damit nicht zu einfach macht.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass es nicht das eine Allheilmittel gibt, aber es Dinge gibt, die dabei helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Die Verhaltenstherapie hat mir geholfen, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass mir etwas helfen kann. Das Medikament hat mir geholfen, mich um einen Therapieplatz zu kümmern. Und die Therapie hilft mir jetzt anzuerkennen, dass ich nicht nur von Woche zu Woche klarkommen muss, sondern dass das eine Sache ist, die mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird, mit der ich aber leben kann.
Glaubst du, dass die Depression irgendwann weggehen wird?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das ein Erkenntnisprozess ist. Bevor ich das einordnen konnte, habe ich mich in den depressiven Phasen 1:1 deckungsgleich mit meinen Emotionen gefühlt. Ich habe gedacht: Jetzt fühle ich mich so, also bin ich schwach. Die Depression, das war sozusagen ich. Durch die Therapie nehme ich sie nur noch als Teil von mir wahr, den ich betrachten und vielleicht nicht kontrollieren, aber einordnen kann.
Wie gehst du mit depressiven Phasen um?
Mir hilft es, das offen zu kommunizieren. Früher habe ich das auch in meiner Familie oder bei Freund*innen nicht offen gesagt, inzwischen sage ich ganz klar, dass ich gerade eine schlechte Phase habe. Das auszusprechen hilft mir, weil es damit an Schrecken verliert und beherrschbarer wirkt. Gleichzeitig nimmt es das Gefühl weg, die anderen im Stich zu lassen oder zu enttäuschen, weil ich klar sage, was Sache ist. Für sich selbst in einem Bereich, in dem man sich sicher fühlt, eine Offenheit herzustellen, das ist etwas, was mir hilft und geholfen hat.